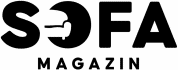3,2 Milliarden Menschen spielen weltweit Videospiele, mehr als je zuvor. Das sind fast doppelt so viele wie Facebook-User. Trotzdem bekommt Gaming in öffentlichen Debatten oft nur einen Platz in der letzten Reihe, wenn überhaupt darüber in Mainstream Medien berichtet wird.
Mehr als „Zocken“: Warum Gaming längst Leitmedium ist
Gaming ist längst kein Nischenphänomen mehr, es ist längst zum Alltag vieler geworden. Rund die Hälfte der Österreicher:innen spielt, sei es am Smartphone, am PC oder an der Konsole. In Bussen wird „Candy Crush“ von Jung und Alt gezockt, abends entspannen sich Menschen mit „Animal Crossing“, und auf Twitch verfolgen Millionen live, wie andere in Echtzeit Welten in „Minecraft“ erschaffen. Die Games-Branche setzt inzwischen mehr um als die Film- und Musikindustrie zusammen. Und doch wird Gaming selten in einem Atemzug mit Kultur, Politik oder Bildung genannt, außer, es geht um Gewalt, Sucht oder Skandale.
Dabei sind Games längst mehr als Unterhaltung für Zwischendurch: Sie erzählen Geschichten von realen oder fiktiven Held:innen, erzeugen Emotionen, fordern Entscheidungen heraus – gute wie schlechte – und ermöglichen soziale Erlebnisse im Online-Spiel mit Freund:innen oder Fremden. Wer sich jemals durch die komplexen moralischen Dilemmata von Life is Strange geklickt oder in It Takes Two mit anderen kooperiert hat, weiß: Games sind empathische, narrative Medien, die Geschichten auf besondere Weise erlebbar machen.
Was sagt die re:publica? Gaming als Spiegel unserer Zeit
Auch auf der re:publica 2025 zeigte sich: Gaming ist nicht nur relevant, es ist ein Schlüssel zur digitalen Kultur. In der Session „Gaming – Das Massenmedium, das wir ignorieren“ wurde deutlich, wie unterrepräsentiert Games trotz ihrer globalen Verbreitung im öffentlichen Diskurs sind. Dabei gäbe es zahlreiche Anknüpfungspunkte in der Bildung, im Journalismus oder in der politischen Kommunikation. Wie viel Potenzial in Games steckt, machte Jasmin Käßer deutlich: „Es ist nicht nur dieses ‚Ich lasse mich mal berieseln und lese was vor‘, sondern ‚Ich greife direkt ins Geschehen ein und sehe – welche Handlung hat welche Auswirkung?‘“. Games ermöglichen es, komplexe, gesellschaftliche Zusammenhänge erfahrbar zu machen und schaffen so Räume, in denen kritisches Denken gefördert wird.
In „Future of Play“ wurde beleuchtet, wie Videospiele generationsübergreifend digitale Kultur formen. Games prägen kulturelle Codes, wirken identitätsstiftend und sind kreative Plattformen. Für viele junge Menschen sind sie das, was Fernsehen oder Popmusik einst waren: ein Ort der Selbstfindung und des Weltverstehens. Noch dazu sind Games politische Räume. Die Session „Modding the Discourse“ machte sichtbar, wie rechte Gruppen versuchen, progressive Inhalte in Spielen zu unterminieren – etwa durch manipulative Mods oder koordinierte Online-Angriffe. Gleichzeitig zeigen queere, feministische und BIPoC-Communities, wie empowernd Games sein können: Sie nutzen sie, um eigene Geschichten zu erzählen, Repräsentation zu schaffen und tradierte Narrative gezielt zu queeren. Ein starkes Statement brachte Carolin Wendt (CD PROJEKT RED) in einer Session auf den Punkt: „Ich hoffe, dass der Satz ‚Ich spiele nicht‘ eines Tages genauso seltsam klingt wie ‚Ich schaue keine Filme‘.“ Ein Wunsch, der deutlich macht: Gaming sollte längst selbstverständlich Teil unseres kulturellen Kanons sein.
Warum wir Games (noch) nicht ernst nehmen
Woran liegt es also, dass Gaming trotz seiner Reichweite und kulturellen Relevanz immer noch nicht als Leitmedium anerkannt ist? Ein zentraler Grund sind hartnäckige Vorurteile. Games gelten oft noch als gewaltverherrlichend, infantil oder isolierend. Ein Bild, das mit der Realität vieler Spieler:innen längst nichts mehr zu tun hat. In der Kulturpolitik fristet Gaming nach wie vor ein Schattendasein: Während Theaterdebatten, Literaturpreise und Filmförderungen breit diskutiert werden, fehlt Games meist die Bühne. Medienwissenschaftler:innen sprechen hier von „kultureller Trägheit“, die langsame gesellschaftlichen Anpassung an neue Medienformen. Während Podcasts, Serien und TikToks längst akzeptiert sind, haftet Games noch immer das Image der „Zockerei“ an.
Ein Medium der Zukunft – und der Gegenwart
Dabei liegt gerade im Gaming enormes Potenzial: für Bildung, Inklusion und Vernetzung. Games erklären komplexe Themen spielerisch, schaffen Räume für Dialog und fördern kreative Ausdrucksformen. Vor allem aber geben sie Stimmen eine Plattform, die im klassischen Mediensystem oft überhört werden.
Die Frage ist längst nicht mehr, ob Gaming ein relevantes Massenmedium ist. Die Frage ist: Wann beginnen wir endlich, es auch als solches zu behandeln?
Mehr über die re:publica 2025 findet ihr hier.