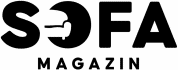Jugendsprache ist mehr als ein Sammelsurium aus Modewörtern oder Internet-Slang. Sie ist Identität, Spielwiese und Gruppencode zugleich. Wer verstehen will, wie junge Menschen denken, muss hinhören, wie sie sprechen. Von „goofy“ bis „rizz“, von Ironie bis Memesprache: Jugendsprache zeigt, wie eine Generation kommuniziert, die in einer vernetzten, digitalen Welt aufgewachsen ist – spontan, kreativ und ständig im Wandel.
Sprache verändert sich seit jeher. Doch was sich heute abspielt, ist neu: Nie zuvor war der Sprachwandel so schnell, global und von digitalen Plattformen geprägt. TikTok, Discord und Twitch sind die neuen Schulhöfe, an denen Wörter entstehen, mutieren und wieder verschwinden, manchmal sogar innerhalb weniger Wochen.
Jugendsprache ist damit nicht nur Ausdruck einer Altersgruppe, sondern auch ein Spiegel unserer Kommunikationskultur. Sie erzählt davon, wie junge Menschen Beziehungen knüpfen, Humor teilen und sich selbst definieren, oft in Abgrenzung zu dem, was die „Erwachsenen“ sagen oder verstehen.
Vom Slang zum Statement
Wer heute durch TikTok scrollt, sieht Sprache in Bewegung. Ein kurzes Video, ein viraler Sound, ein Kommentar mit Millionen Likes und plötzlich sagen alle „delulu“ oder „based“. Jugendsprache funktioniert längst nicht mehr linear. Sie breitet sich in Echtzeit über Plattformen und Ländergrenzen hinweg aus. Wörter sind dabei nicht nur Mittel zur Verständigung, sondern auch Teil eines sozialen Spiels: Sie markieren Zugehörigkeit, Ironie und Selbstbewusstsein.
Begriffe wie „slay“, „rizz“ oder „goofy“ werden von Content-Creator:innen auf TikTok und YouTube geprägt, von Streams übernommen und schließlich in die Alltagssprache vieler jungen Menschen integriert. Daraus entsteht ein hybrider Wortschatz, welcher Englisch, Deutsch und Meme-Kultur zu einer neuen Sprachform verschmelzen lässt. Die Bedeutung von Jugendsprache liegt also weniger im einzelnen Wort, sondern in der Haltung, die dahintersteckt. Die Ausdrucksweise kann dabei frech, ironisch, kreativ und manchmal bewusst überzogen sein.
Jugendwort des Jahres: Österreichs Sprachtrends 2025
Wie jedes Jahr kürt der Langenscheidt Verlag auch heuer seine beliebtesten Jugendwörter. Hier ein kleiner, aber aufschlussreicher Einblick in den aktuellen Sprachkosmos:
- „Checkst du“: wird am Ende eines Satzes genutzt, um sicherzustellen, dass das Gegenüber wirklich verstanden hat, worum es geht. Eine neue Variante von „Verstehst du?“
- „Das crazy“: Ausdruck der Sprachlosigkeit, vergleichbar mit „Aha, cool“ oder „Okay“. Wird verwendet, wenn einem nichts mehr einfällt oder man das Gespräch am Laufen halten will.
- „Digga(h)“: Slangwort für Freund:in oder einfach irgendeine Person. Vielseitig einsetzbar als Anrede, Ausruf oder Reaktion.
- „Goonen“: ursprünglich aus der Online-Subkultur, steht für exzessives Verhalten, wird mittlerweile aber allgemein für Selbstbefriedigung verwendet.
- „Lowkey“: bedeutet „ein bisschen“, „unauffällig“ oder „unterschwellig“. Perfekt, um Gefühle vorsichtig auszudrücken.
- „Rede“: Ausruf der Zustimmung: „Lauter! Genau das!“, wenn man einer Aussage besonders zustimmt.
- „Schere“: aus der Gaming-Szene und steht sinngemäß für „Mein Fehler!“. Eine symbolische Geste der Entschuldigung, etwa wie ein Handzeichen nach einem Foul.
- „Sybau“: steht für „Shut your bitch ass up“, wird vor allem ironisch in Kommentaren oder Videos verwendet. Eine jugendliche, humorvolle Variante von „Halt die Fresse“.
- „Tot“: beschreibt peinliche, lahme oder unangenehme Situationen. Beispiel: Niemand tanzt auf der Party, alle starren aufs Handy – tot.
- „Tuff“: positives Slangwort für „krass“, „cool“ oder „beeindruckend“. Wird genutzt, um Bewunderung auszudrücken.
Die Auswahl 2025 zeigt, dass Jugendsprache 2025 stark von der Online-Kultur und Gaming-Szene geprägt ist und gleichzeitig von ironischer Distanz lebt. Viele dieser Wörter klingen für Außenstehende merkwürdig. Doch sie erfüllen eine klare Funktion und schaffen Gemeinschaft. Wer die Begriffe versteht, gehört dazu. Und wer sie nutzt, spielt mit Sprache, des Öfteren auch mit ironischem Unterton.
Sprache, die verbindet
Jugendsprache ist mehr als ein Trend. Sie schafft Gemeinschaft, Humor und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Wenn Jugendliche Begriffe wie „lowkey“, „checkst du“ oder „tuff“ verwenden, geht es selten nur um Wörter, sondern um Haltung. Es ist ein Spiel mit Sprache, das gleichzeitig Nähe und Abgrenzung ausdrückt. Gerade in Österreich zeigt sich, wie bunt und kreativ diese Sprachmischung ist. Dialekte treffen auf Anglizismen, Internetkultur auf Alltag und daraus entsteht ein Sprachstil, der so lebendig ist wie die Generation, die ihn spricht.
Mehr als Wörter
Jugendsprache ist oft laut, chaotisch und kurzlebig, aber auch ehrlich. Sie zeigt, wie junge Menschen sich Raum schaffen in einer Welt, die sie permanent kommentiert und bewertet. Sie erfinden ihre Sprache neu, weil sie in keiner vorgegebenen Sprache mehr ganz zu Hause sind. Zwischen „cringe“ und „slay“ steckt also weit mehr als nur Trend. Es steckt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Individualität und Ausdruck dahinter.
Und vielleicht ist das Schönste daran, dass Sprache und Jugendsprache nie stillstehen. Sie verändert sich, wie ihre Sprecher:innen selbst. Heute „delulu“, morgen „based“ und übermorgen schon wieder etwas völlig anderes. Was bleibt, ist die Freude daran, sich mit Sprache neu zu erfinden, immer wieder, immer anders.