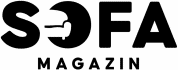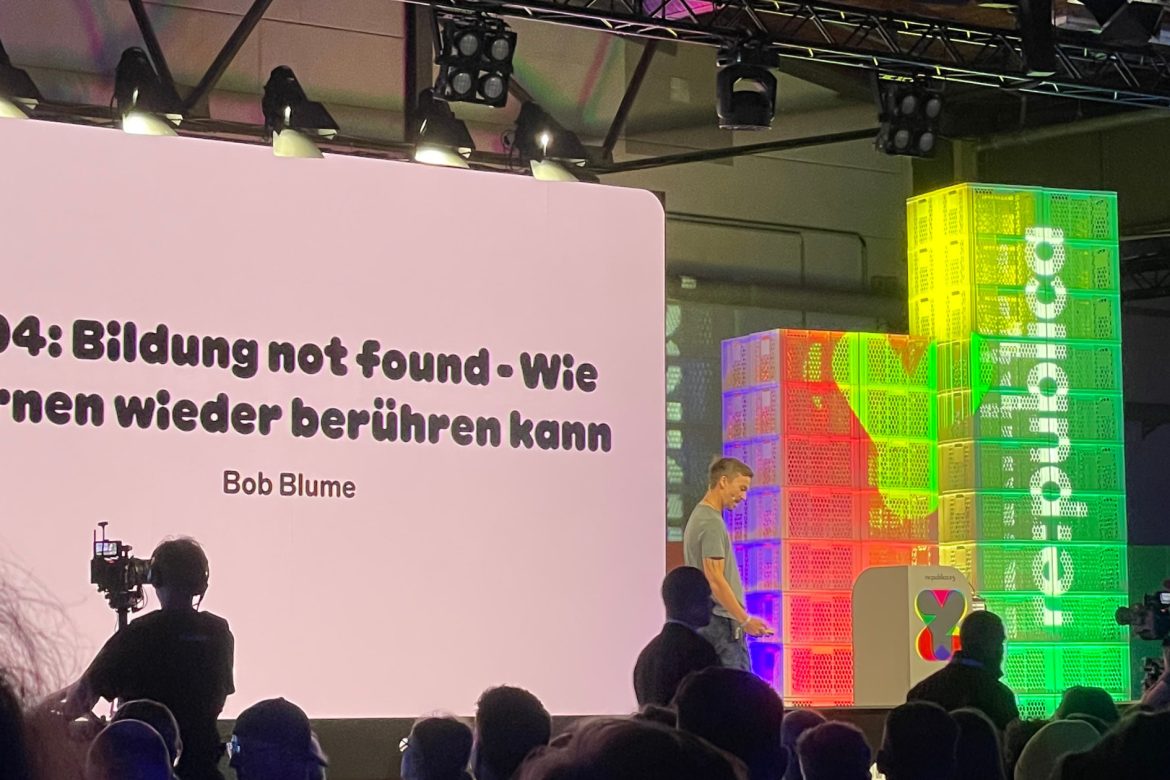Ein Beitrag inspiriert von Bob Blume – Vortrag bei der Republica 2025, neu gedacht für Österreich
In Österreich verlassen jährlich rund 7.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss.
Zum Vergleich: In Deutschland sind es etwa 50.000.
Rechnet man das auf die Bevölkerung um, liegt Österreich im ähnlichen Bereich – und das zeigt: Auch hierzulande verliert das Bildungssystem junge Menschen, lange bevor es sie wirklich erreicht hat.
Bildung ist nicht mehr attraktiv genug
In einer Welt, die sich rasant verändert, wirkt das österreichische Schulsystem oft wie aus der Zeit gefallen. Schulpflicht ja – aber Begeisterung? Fehlanzeige.
Mehr als 60 % der Jugendlichen fühlen sich nicht eingebunden – ähnlich wie in Deutschland, wo rund zwei Dritteldas Interesse am Unterricht verlieren.
Warum? Weil Schule selten nach Zukunft klingt – sondern nach „du musst“, „du sollst“, „du darfst nicht“.
Psychische Gesundheit: Die stille Krise
In Österreich zeigen Studien, dass rund 20 % der Jugendlichen psychisch belastet sind – mit Symptomen wie Angst, Antriebslosigkeit oder Depression.
In Deutschland ist die Zahl ähnlich hoch.
Was fehlt, ist nicht nur therapeutische Hilfe – sondern ein Bildungssystem, das stabilisiert statt überfordert.
Corona: Der Wendepunkt – oder die verlorene Chance?
Während der Pandemie wurden Schwächen im System sichtbar:
Fehlende digitale Infrastruktur, soziale Ungleichheit, Überforderung bei Lehrenden wie Lernenden.
Die Hoffnung war groß, dass sich nach Corona etwas ändert.
Doch was ist passiert?
Lehrpläne sind geblieben. Prüfungen auch.
Dabei hat sich das Lernen längst verlagert:
Schüler:innen googeln, schauen Tutorials, nutzen ChatGPT.
In Deutschland wie in Österreich ist klar: Die Schule ist nicht mehr die einzige Instanz für Wissen.
Aber sie tut oft noch so, als wäre sie es.
Das pädagogische Missverständnis
Hausübungen?
Viele schreiben sie mit Hilfe von KI.
Klausuren?
Kaum jemand lernt mehr dafür, um „es zu verstehen“, sondern nur, um durchzukommen.
Was fehlt, ist ein System, das Verstehen über Bewertung stellt.
Das Zukunftskompetenzen über Prüfungswissen stellt.
In beiden Ländern sehen wir: Jugendliche wollen lernen – aber sie wollen nicht geprüft werden wie Maschinen.
Wie bereiten wir Kinder auf eine Welt vor, die wir selbst nicht kennen?
Die Zukunft ist ungewiss – und genau deshalb müssen wir junge Menschen stärken, nicht nur füttern mit Wissen.
Was sie brauchen:
- Kritisches Denken
- Kreativität
- Teamfähigkeit
- emotionale Intelligenz
- digitale Souveränität
Diese Fähigkeiten gelten heute als „21st Century Skills“.
In Finnland oder Estland stehen sie längst im Zentrum.
In Österreich und Deutschland?
Oft bestenfalls im Begleittext des Lehrplans.

Wenn Schule berührt, entsteht Magie
Bob Blume bringt es auf den Punkt:
„Es muss knistern im Klassenzimmer.“
Nicht im Sinne von Spannung – sondern von Energie zwischen Menschen.
Wenn Schüler:innen spüren, dass sie wichtig sind – passiert Bildung von selbst.
Soziale Schieflage: In Österreich besonders spürbar
In kaum einem anderen europäischen Land hängt der Bildungserfolg so stark vom Elternhaus ab wie in Österreich.
Laut OECD ist die soziale Durchlässigkeit im Schulsystem hier besonders gering – Deutschland steht ebenfalls schlecht da, aber Österreich schneidet noch etwas schwächer ab.
Das zeigt:
Wenn Schule auf Zuhause setzt – verlieren die, die dort keine Hilfe haben.
Was wir in Österreich (und darüber hinaus) brauchen
- Mehr Lehrkräfte – mit Zeit für Beziehung, nicht nur Korrektur
- Mehr Schulpsycholog:innen und Sozialarbeiter:innen – flächendeckend
- Weniger Zentralisierung, mehr Schulautonomie
- KI als Chance nutzen, nicht als Feindbild behandeln
- Mut zur Veränderung – auch wenn sie unbequem ist
Fazit: Bildung braucht Beziehung – nicht nur Regeln
In Deutschland wie in Österreich diskutieren wir viel – und verändern wenig.
Aber wir können es besser machen.
Wir wissen, was hilft:
Vertrauen. Menschlichkeit. Mut.
Bildung ist kein Download.
Sie ist ein Prozess – eine produktive Verwicklung.
Sie braucht Neugier, Offenheit, Fehler – und vor allem: Berührung.