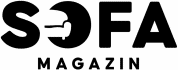Das Studium gilt für viele als eine der spannendsten, aber auch herausforderndsten Lebensphasen. Zwischen Prüfungen, Nebenjobs, Zukunftsängsten und finanziellen Sorgen bleibt oft wenig Raum, um auf die eigene mentale Gesundheit zu achten. Der Druck, immer funktionieren zu müssen, begleitet viele Studierende täglich – und führt nicht selten an die Grenzen der Belastbarkeit.
„Es sei einfach viel“ – Überforderung als ständiger Begleiter
Psychotherapeutin Sandra Frank beschreibt das Studium als „viel – einfach viel“. Sie sagt, neben dem hohen Lern- und Prüfungsaufwand sei es vor allem der ständige Leistungsdruck, der die Psyche belaste. Studierende hätten oft das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen. In einer Zeit, in der ein „Vierer“ schon als Versagen gelte und es in den sozialen Medien so scheine, dass jeder Student den Job und das Privatleben mühelos unter einen Hut bringe, verschöben sich die Maßstäbe. Das führe dazu, dass viele das Gefühl hätten, nie genug zu leisten – egal, wie sehr sie sich bemühten.
Nachwirkungen der Pandemie
Seit der Corona-Pandemie hätten sich diese Belastungen zusätzlich verschärft. Viele berichteten, dass sie immer noch Schwierigkeiten hätten, wieder in einen geregelten Rhythmus zu finden. Das ständige Gefühl von Anspannung und Überforderung könne zu Dauerstress führen – und dieser habe gravierende Folgen für die mentale Gesundheit. Wenn der Körper keine Möglichkeit mehr bekomme, sich zu erholen, begännen Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und Erschöpfungsschleifen, die sich gegenseitig verstärkten. So entstehe ein Teufelskreis aus Stress und Schlaflosigkeit, aus dem man ohne Hilfe kaum mehr herausfinde.
Warnsignale ernst nehmen
Ein Warnsignal dafür, dass der Stress krank mache, sei laut Sandra Frank, wenn das Abschalten nicht mehr gelinge; wenn man abends nicht mehr einschlafen könne, weil man innerlich „weiterarbeite“, oder wenn alle Aufgaben gleich wichtig erschienen und der Kopf keine Ordnung mehr finde. Auch körperliche Symptome wie innere Unruhe, Zittern oder permanente Anspannung seien Zeichen, dass es zu viel geworden sei.
Sich selbst ernst nehmen und Hilfe annehmen
Der wichtigste Schritt sei es, sich selbst ernst zu nehmen. Viele versuchten, einfach weiter zu funktionieren – doch das verschlimmere die Situation lediglich. Frank betont, es sei völlig okay, wenn einem etwas zu viel werde. Wer merke, dass der Alltag nicht mehr bewältigbar sei, solle das offen ansprechen – mit Freund:innen, Familie oder Kommiliton:innen. Schon das Aussprechen könne entlasten und helfen, wieder einen klareren Kopf zu bekommen.
Trotzdem falle es vielen schwer, sich professionelle Unterstützung zu holen. Der Gedanke, „so schlimm ist es ja eh noch nicht“, sei weit verbreitet – und laut Sandra Frank genau das Problem. Wenn man so denke, sei das schon ein Zeichen, dass etwas nicht stimme. Hilfe anzunehmen bedeute nicht, schwach zu sein, sondern Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Dabei müsse es nicht immer gleich eine Therapie sein. Es gebe etwaige Angebote, etwa die Psychologische Studierendenberatung, die österreichweit kostenlose und vertrauliche Unterstützung biete.
Weiters betont Sandra Frank, dass auch das Umfeld eine wichtige Rolle spiele. Wenn Freund:innen oder Mitbewohner:innen signalisierten, dass jemand überfordert wirke, solle man das ernst nehmen – und nicht schönreden. Frühes Handeln könne verhindern, dass aus Überforderung eine psychische Krise werde.
Zum Abschluss erinnere sie daran, dass niemand mit diesen Problemen allein sei. Psychische Belastungen im Studium seien keine Ausnahme, sondern Realität für viele. Wer sich rechtzeitig Unterstützung hole, könne lernen, besser mit Stress umzugehen. Und für akute Situationen gelte: Hilfe sei jederzeit erreichbar – zum Beispiel anonym und rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter 142.