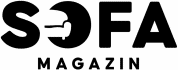Ein Erfahrungsbericht
Traurig aus dem Kindergarten heimkommen, weil niemand meine Sprache verstanden hat, Entschuldigungen an meine Lehrer*innen Korrektur lesen, damit keine Rechtschreibfehler drinnen sind – aber auch: eine zusätzliche Sprache fließend sprechen und Vorteile im schulischen, beruflichen und universitären Alltag haben. Zweisprachig aufwachsen hat zwei Seiten.
Zweisprachigkeit – immer schon positiv?
Wie ist das Leben, wenn man zweisprachig aufwächst? Wenn ich heutzutage Menschen erzähle, dass ich bilingual aufgewachsen bin, bekomme ich nur positives Feedback. Ich höre oft: „Ach, dass muss ja cool sein, wenn man von Anfang an fließend eine andere Sprache kann.“ Und ja, das ist es auch – jetzt.
Ich – und viele andere Menschen, deren Familien nach Österreich und Deutschland emigriert sind, haben Vorteile, weil sie mehrere Sprachen sprechen. Das ist aber nicht immer so gewesen und war vor allem als Kind nicht so.
Kurz zu mir persönlich: ich bin in einem kleinen Ort in Deutschland aufgewachsen, mit einem deutschen Vater aber fast ausschließlich bei meiner irischen Mutter.
Man betont Wörter anders, man kennt einige Begriffe nur in seiner zweiten Muttersprache oder wird gefragt, warum die Elternteile „so komisch reden“. Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir viele Beispiele ein, bei denen ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich anders bin. Man soll mich nicht falsch verstehen, ich bin froh, dass ich bin, wie ich bin und zwei kulturelle Identitäten in mir trage. Dennoch ist es gerade beim Aufwachsen manchmal einfach nicht schön gewesen, wenn man eben nicht „gleich“ wie die heimischen Kinder war.
Andersartigkeit im Kindheitsalter
Sabrina hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihre Eltern sind auf Grund des Jugoslawienkriegs nach Österreich geflohen. Hier ist auch Sabrina geboren und aufgewachsen. Im Kindergarten hat auch sie sich manchmal gewundert, warum die anderen Kinder kein BKS (Bosnisch-Kroatisch-Serbisch) sprechen.
Wenn man auf Deutsch und einer anderen Sprache spricht, bringt man Wörter durcheinander. „Manchmal habe ich einige Sachverhalte nicht so auf Deutsch erklären können, wie ich es wollte, weil ich zuhause auf BKS geredet habe und andersherum“, erklärt Sabrina. Ich erkenne mich in ihrer Schilderung wieder. Auch heute noch erwische ich mich dabei, dass ich einige Begriffe nur auf Englisch kenne und benutze.
Gerade im Heranwachsen und der Pubertät wird einem immer mehr bewusst, dass man nicht den exakt gleichen Hintergrund teilt, wie andere. „Ich habe in der Schule, vor allem wenn ich unter Österreicher*innen war, anfangs ungerne erzählt, dass ich zuhause kein Deutsch spreche“, erklärt Sabrina. So wie Sabrina geht es vielen Jugendlichen, die gerade in der vulnerablen Phase des Heranwachsens sind und sich durch ihre Zweisprachigkeit anders fühlen.
Andere Muttersprache = mehr Vorurteile?
Wenn man eine zweite Sprache spricht, werden die Deutsch-Kenntnisse oft in Frage gestellt. Nicht selten hört man Aussagen wie: „Ach du sprichst ja gut Deutsch“ oder im Fall von Sabrina: „Also dafür, dass du erst seitdem du drei Jahre alt bist Deutsch sprichst, kannst du das ja ganz toll.“
Ja, danke, können wir und andere auch. In den meisten Fällen sind Menschen die bilingual aufgewachsen sind in dem Land geboren oder sprechen die heimische Sprache mit einem anderen Elternteil, beziehungsweise im Sozialleben. Denn, nur weil man eine zweite Sprache von Haus aus kann, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass man die landestypische Sprache nicht beherrscht.
So geht es aber nicht allen. Freunde von Sabrina und mir haben Elternteile, die eine andere Sprache als Muttersprache haben und deren Kinder sie nie gelernt haben. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: Scham, die Angst davor, dass die Kinder als andersartig angesehen werden oder den Wunsch, dass Kinder ausschließlich die Landessprache können.
Zweisprachigkeit als Gewinn
Neben vielen Stereotypen, mit denen man als bilinguale Person konfrontiert ist, hat diese kulturelle Doppelidentität aber auch schöne, vorteilhafte Seiten. Man erlebt österreichische und bosnische Kultur oder in meinem Fall deutsche und irische Kultur. Man kann sich als Teil von zwei Kulturen sehen, wenn man das möchte. Man erweitert seinen Horizont und zieht sehr viel positives aus unterschiedlichen Essgewohnheiten, Sitten und Feiertagen.
Wenn man die Zweisprachigkeit als erwachsene Person betrachtet, überwiegen vor allem die Vorteile und die positiven Seiten. Sabrina erklärt, dass sie froh sei beide Sprachen zu können und beide Kulturen in ihrem Leben zu haben. Ich kann ihr da nur beipflichten: Ich liebe meine beiden kulturellen Identitäten und wäre sonst nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Das anders sein kann man zelebrieren – denn was wäre die Welt, wenn wir alle gleich sprechen und agieren würden?
Mein Wunsch für die Zukunft
Mein persönlicher Wunsch für alle Kinder, die jetzt bilingual aufwachsen und es in Zukunft werden ist, dass die Gesellschaft diese Andersartigkeit nicht mehr stigmatisiert, sondern als Stärke sieht. Wir sind alle Bewohner*innen eines Landes und bringen mit unseren unterschiedlichen Blickwinkeln und Sprachen Positives dazu. Ich wünsche mir, dass kein Kind mehr ausgelacht wird, weil es das g in „gucken“ zu sehr betont und nicht als k sagt. Ich wünsche mir, dass niemand mehr gefragt wird, woher der komische Vorname kommt. Ich wünsche mir einfach Toleranz und eine schöne Kindheit für alle, egal wie viele Sprachen sie noch zusätzlich sprechen oder nicht sprechen.
Vielleicht ein utopischer Wunsch – let’s see, you can keep on dreaming. Go raibh math agat.