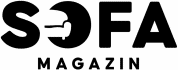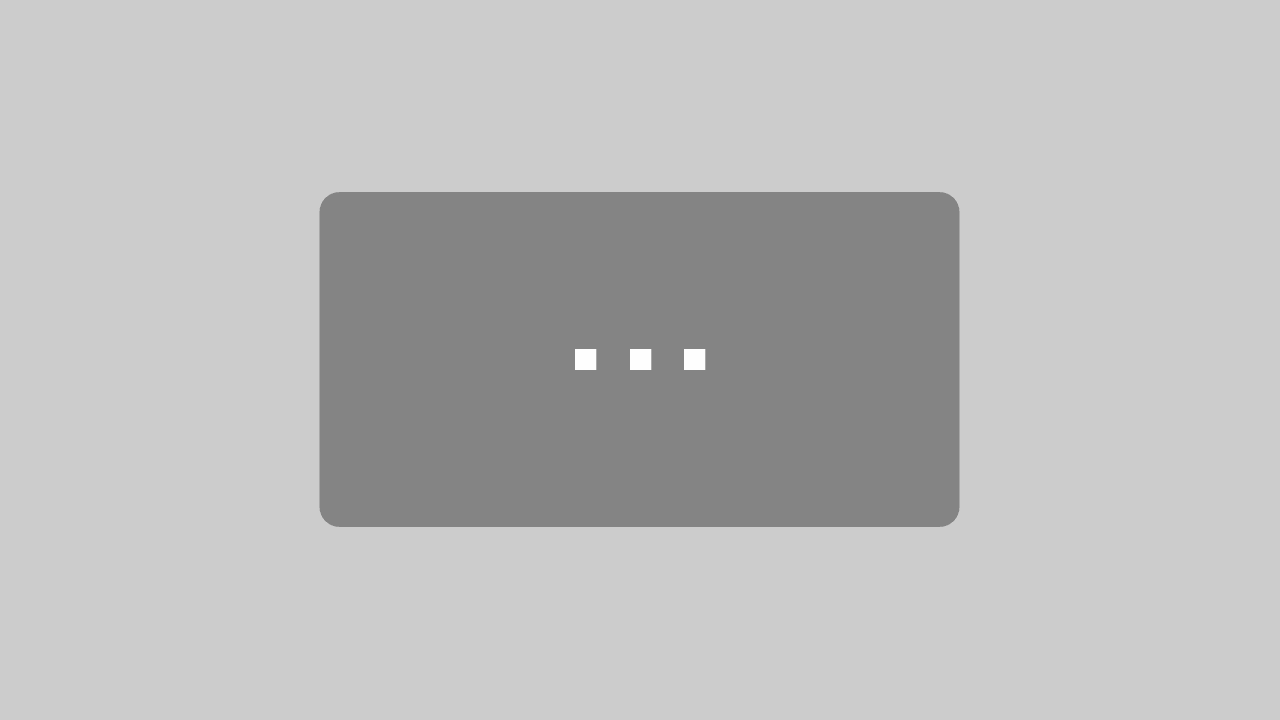Die typische Prüfungsphase: Die Aufgabenliste wächst, der Schreibtisch ruft – und dennoch findet sich immer eine „dringendere“ Beschäftigung. Plötzlich werden die Pflanzen gegossen, der Schreibtisch säuberlich aufgeräumt, oder doch die Lieblingsserie fertig geschaut.
Dieses Phänomen hat einen Namen: Prokrastination. Oder wie es in Österreich so schön heißt: Aufschieberitis. Doch was genau treibt uns zu diesem Verhalten, und wie können wir es überwinden?
Prokrastination: Was steckt dahinter?
Prokrastination: Das absichtliche Verschieben von Aufgaben trotz negativer Konsequenzen, ist keine Seltenheit. Insbesondere bei Studierenden ist dieses Verhalten verbreitet und hat wenig mit Faulheit zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine komplexe Reaktion unseres Gehirns auf Herausforderungen und Emotionen.
Eine zentrale Ursache liegt in der subjektiven Wahrnehmung von Aufgaben. Wenn eine Tätigkeit als schwierig, langweilig oder unangenehm empfunden wird, löst sie Abwehrreaktionen aus. Unser Gehirn klassifiziert solche Aufgaben als „aversiv“ und sucht nach Alternativen, die kurzfristig angenehmer erscheinen. Das können Aktivitäten wie Fernsehen oder belanglose Hausarbeiten sein. Kurzfristig verringern diese Ablenkungen unangenehme Gefühle wie Stress oder Unsicherheit – langfristig jedoch vergrößern sie den Druck.
Auch Perfektionismus ist häufig ein Mitverursacher. Die Angst, nicht den eigenen Ansprüchen zu entsprechen, kann dazu führen, dass der Start einer Aufgabe hinausgezögert wird. Oft schwirren Gedanken im Gehirn herum wie: „Die Aufgabe ist sowieso viel zu schwer und ich werde sie nicht zufriedenstellend erledigen“.
Unser Gehirn ist beim Prokrastinieren ein wichtiger Faktor, insbesondere zwei Bereiche. Die Amygdala, der emotionale Teil, meldet bei Stress oder Angst: „Diese Aufgabe ist unangenehm, mach lieber etwas anderes.“ Der präfrontale Kortex, zuständig für Planung und Kontrolle, hält dagegen: „Das ist wichtig, du musst es machen!“ Wenn die Amygdala stärker ist, setzen wir uns nicht durch und schieben die Aufgabe auf.
Ist Prokrastination immer negativ?
Nicht unbedingt! In bestimmten Fällen kann gezieltes Aufschieben sogar förderlich sein. Unter Druck entstehen oft kreative Ideen, und sogenannte „aktive Prokrastinierer“ nutzen die Deadline als Antrieb. Problematisch wird Prokrastination jedoch, wenn sie zur Gewohnheit wird und die persönliche Produktivität oder das Wohlbefinden beeinträchtigt.
Was kann dagegen unternommen werden?
- Schaffe dir ein gutes Umfeld, in dem du deinen Arbeitsplatz aufräumst, Ablenkungen wie dein Handy entfernst und vielleicht eine motivierende Playlist erstellst. Eine klare Umgebung fördert einen klaren Kopf.
- Eine bewährte Methode ist die Pomodoro-Technik: Arbeite 25 Minuten konzentriert, gefolgt von einer fünfminütigen Pause. Das gibt dir Struktur und verhindert Überforderung.
- To-Do-Listen mit kleinen Schritten sind ebenfalls hilfreich. Teile deine Aufgaben in überschaubare Teile wie „Recherche starten“ oder „Einleitung schreiben“ – jeder abgehakte Punkt motiviert dich, weiterzumachen.
Wenn Prokrastination für dich ein größeres Problem ist, helfen langfristige Strategien.
- Reflektiere, warum du aufschiebst – fühlst du dich überfordert, hast du Angst oder fehlt dir die Motivation? Wenn du den Grund kennst, kannst du gezielt dagegen steuern.
- Übe außerdem Selbstmitgefühl: Es ist okay, nicht immer alles sofort zu schaffen. Statt dich zu kritisieren, sei freundlich zu dir selbst – das nimmt Druck weg.
- Baue Gewohnheiten auf, indem du feste Zeiten für deine Aufgaben einplanst, zum Beispiel: „Nach dem Frühstück arbeite ich 25 Minuten.“ Mit der Zeit wird das zu einer hilfreichen Routine.
Aber am Allerwichtigsten ist: Sei nicht zu streng zu dir, beginne mit kleinen Schritten und belohn dich für deine Fortschritte!