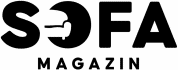Warum Studierende Symptome ernst nehmen sollten
Hinweis/Content Note: In diesem Artikel geht es um psychische Belastungen, Depression, Burnout und auch um Suizidgedanken. Wenn dich solche Inhalte mitnehmen, lies bitte achtsam weiter. Und wenn du merkst, dass sich etwas schlecht anfühlt, leg eine Pause ein oder sprich mit jemandem darüber. Du musst das nicht allein tragen.
Studieren bedeutet oft viel zu wollen und gleichzeitig wenig Zeit zu haben. Es geht um Prüfungen, Deadlines, Zukunftsentscheidungen und den Wunsch, alles richtig zu machen. Doch manchmal kippt der Druck ins unermessliche und man fällt in ein “Loch“. Viele Studierende kennen Phasen tiefer Erschöpfung oder Niedergeschlagenheit. Die Frage ist dann, ob es sich um ein Burn-out handelt oder eine Depression dahintersteckt.
Unterschiede von Burn-out und Depression
Burn-out wird im internationalen Klassifikationssystem ICD 10 als berufsbezogenes Belastungsphänomen beschrieben, ausgelöst durch anhaltenden Stress. Es betrifft die berufliche Rolle und die damit verbundenen Erwartungen. Eine Depression dagegen ist eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung. Sie betrifft alle Lebensbereiche, tritt unabhängig vom konkreten Umfeld auf und ist nach den Kriterien des Klassifikationssystems ICD 10 klar definiert. Dazu gehören depressive Stimmung, Verlust von Interessen und Freude sowie ein deutlich verminderter Antrieb. Häufig kommen Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaf und Appetitveränderungen, Schuldgefühle oder pessimistische Zukunftsaussichten dazu.
Wo die Grenzen verschwimmen
In der psychologischen Praxis ist die Unterscheidung oft nicht sofort eindeutig. Die Klinische Psychologin und Rechtspsychologin Mag. Mercedes Haindl erklärt: „Ich sehe in meinem Praxisalltag einige Überschneidungen der Symptome bei Depressionen und beim Burn-out. Manchmal liegt die erste Verdachtsdiagnose bei Burn-out, da es medial in den letzten Jahren häufig thematisiert wurde. Man muss sich jede Person individuell ansehen und mit differentialdiagnostischen Tools eine Diagnose erstellen.“
Das unterstreichen auch wissenschaftliche Studien. Sie zeigen, dass viele Symptome sehr ähnlich sein können und deshalb die Kontextfrage entscheidend sei. Besteht die Erschöpfung nur im Rahmen von Studium oder Beruf spricht das eher für das Burn-out-Syndrom. Bleibt die Erschöpfung jedoch bestehen, auch wenn der Stress nachlässt, kann das auf eine Depression hindeuten.
Was die Statistik zeigt
Genaue Zahlen für Studierende sind selten, aber die allgemeine Lage von Statista.de zeigt, wie wichtig das Thema ist: In Deutschland zum Beispiel liegt die Lebenszeitprävalenz für Depressionen bei etwa 15,5 Prozent bei Frauen und bei 8,2 Prozent bei Männern. Zur Burn-out-Prävalenz existieren nur grobe Schätzungen.
Warnsignale erkennen
Achte besonders auf folgende Anzeichen, wenn sie über mehrere Wochen hinweg auftreten oder sich verstärken:
- Anhaltende Niedergeschlagenheit oder innere Leere
- Verlust von Freude oder Interessen
- Deutliche Antriebslosigkeit oder extreme Müdigkeit
- Konzentrationsprobleme
- Vermindertes Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle
- Negative Zukunftserwartungen
- Schlaf oder Appetitveränderungen
- Sozialer Rückzug
- Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid
Wie Diagnosen gestellt werden
Basis einer Diagnose ist immer ein fachliches Gespräch mit einer ärztlichen oder psychologischen Fachperson. Standardisierte Fragebögen können unterstützen. Wichtig ist auch die Einbeziehung von Vorerkrankungen und der familiären Vorgeschichte.
Mercedes Haindl betont die Bedeutung früher Diagnosen: „Je früher eine Depression behandelt wird, desto günstiger ist in der Regel der Verlauf. Unbehandelt kann die Erkrankung schwere soziale und gesundheitliche Folgen haben.“
Die Dauer einer depressiven Episode hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von biologischen Einflussfaktoren und der Frage, ob eine Kombination aus Psychotherapie und Medikamentenmöglichkeiten genutzt wird. Mercedes Haindl schätzt, dass mindestens sechs Monate realistisch seien, je nach Schweregrad und Ressourcen der betroffenen Person.
Was Studierende tun können
Wer erste Anzeichen bei sich selbst erkennt, sollte frühzeitig Hilfe suchen. Die psychosozialen Beratungsstellen an Hochschulen oder der ÖH sind ein guter Anfang: niedrigschwellig, leistbar und oft genau der Ort, an dem man zum ersten Mal laut aussprechen kann, dass man das Gefühl hat, etwas stimme nicht. Was man dabei aber selten gesagt bekommt: Die Suche nach einem Therapieplatz fühlt sich derzeit manchmal an wie die Wohnungssuche in Wien. Es gibt zu wenige Plätze, zu viele Menschen brauchen sie, und je günstiger der Platz, desto länger die Warteliste. Der Mangel an Fachkräften und Therapiekapazitäten sorgt dafür, dass die meisten nicht sofort starten können, auch wenn dringender Bedarf besteht.
Mercedes Haindl empfiehlt den ersten Schritt nicht aufzuschieben. Ein Gespräch bei einer Beratungsstelle oder der Hausärztin kann die Wartezeit überbrücken, Orientierung geben und verhindern, dass alles noch schwerer und stiller wird. Auch wenn der Weg zur Therapie länger dauert als gehofft, anfangen lohnt sich immer früher als später. Im Ernstfall gilt: Nicht warten und nicht allein bleiben.
Vorbeugung im Studienalltag
Zur Prävention von psychischer Belastung im Studium helfen regelmäßiger Ausgleich durch Sport, bewusste Freizeitgestaltung, ausreichend Schlaf sowie das Pflegen sozialer Kontakte. Mercedes Haindl empfiehlt zudem einen „Werte-Check“. Dabei gehe es darum sich zu fragen, für wen man das Studium eigentlich mache, welche Erwartungen man erfüllen wollen würde und welche eigenen Werte im Alltag zu kurz kommen würden. Dieser simple Check kann helfen Überforderung rechtzeitig zu erkennen und aktiv gegenzusteuern.