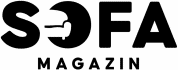Zukunftsängste, Neugier, Faszination: Wir alle begegnen Künstlicher Intelligenz mit anderen Gefühlen. Seit Ende 2022 kann die breite Öffentlichkeit ChatGPT nutzen. 2023 ist die Technologie bei vielen angekommen. Damit wurde die Diskussion rund um dieses komplexe Thema erneut entfacht. Aber welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz auf die Arbeitswelt der Zukunft? Ersetzt die Maschine wirklich bald Arbeitsplätze und müssen Menschen um ihre Jobs fürchten?

Einen Suchbegriff in eine Suchmaschine weltweit einzugeben war gestern. In einer Enzyklopädie blättert schon lange niemand mehr. Viele nutzen die erstaunliche Künstliche Intelligenz-Technologie “ChatGPT”, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Das erleichtert nicht nur den Alltag, sondern hilft auch oft im Studium oder im Beruf. Künstliche Intelligenz ist jedoch schon länger Teil unseres Alltags als viele ahnen. Mathematische Vorhersagemodelle begegnen uns etwa im Social Media-Feed, bei Empfehlungen im Online Shopping und vielem mehr. Auch in der Arbeitswelt vieler hat Künstliche Intelligenz mittlerweile einen fixen Platz. Durch den rasanten Fortschritt fürchten viele Menschen jetzt jedoch um ihre Arbeitsplätze. Sicher ist, dass ChatGPT und andere Formen Künstlicher Intelligenz die Arbeitswelt verändern werden.
So funktioniert’s
Aber wie funktioniert der scheinbare Zauber hinter ChatGPT und Co.? Hinter den Antworten und Ergebnissen steckt eine komplizierte Technologie. Kurz erklärt werden riesige Datenmengen herangezogen und ausgewertet. Im Gegensatz zu Suchmaschinen-Treffern hat man bei dieser Technik den Eindruck, sich wirklich mit einem virtuellen Gegenüber zu unterhalten. Ganze Dialoge können so mit Künstlicher Intelligenz als Gegenüber entstehen. Durch ständiges Füttern der Algorithmen, etwa durch vermehrte Suchanfragen zu einem Thema, wird die Treffsicherheit der Antworten stetig erhöht.
Die Künstliche Intelligenz lernt also durch das Nutzungsverhalten vieler Menschen auf der ganzen Welt. Es ist sozusagen eine Abkürzung, die man einschlägt, um an die gewünschte Antwort zu kommen. Oft stößt man auch über Begriffe wie „maschinelles Lernen“ oder „Deep Learning“. Auch das bezeichnet technologische Systeme, die mit Hilfe von Daten ständig lernen. Durch Eingabe von Suchbegriffen oder konkreten Fragen können immer wieder neue Verbindungen zwischen Inhalten erstellt werden. Systeme werden so stetig besser und präziser. Wie auch beim menschlichen Lernen ist das maschinelle Lernen ein Prozess, der aktuell stärker denn je befeuert wird.
Das heißt?
Das klingt doch erstmal gut. Erleichtert es uns doch viele Aufgaben, wie etwa die stundenlange Suche nach einem bestimmten Trick zur Fotobearbeitung oder einer schnellen Inhaltsanalyse zu einem Text, den man nicht gelesen hat. Denn wir Menschen sind oft faul und suchen den kürzesten Weg zur Lösung.
Aber auch Zweifel werden im Hinblick auf die Technologie laut. Ersetzt die Maschine bald wirklich den Menschen? Werden Arbeitsplätze, wie wir sie heute kennen, bald nicht mehr von Personen besetzt? Wie weit ist die Forschung mit der Entwicklung menschenähnlicher Roboter? Und können diese Roboter vielleicht sogar mehr, als wir Menschen uns bis jetzt vorstellen können? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz – jetzt und in der nahen Zukunft? Werden die klug erscheinenden Systeme bald die Überhand gewinnen? Wo liegen die Grenzen von maschinellem Lernen?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich nicht nur die Nutzer:innen, auch Arbeitsexpert:innen stecken mitten in der Forschung. Unter anderem beschäftigt sich die österreichische Arbeiterkammer mit der zukünftigen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und Arbeitswelt.
Eines ist klar: Veränderung kommt
Klar ist, dass einige Arbeitsabläufe durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz schneller erledigt werden können. Eine gezielte Verwendung der Technologie kann also durchaus unterstützend, nicht aber ersetzend sein. Arbeitnehmer:innen sind hier selbst gefragt, Künstliche Intelligenz für sich und für ihren Arbeitsalltag kompetent und zielführend einzusetzen. Das bedeutet jedoch, dass Menschen in bestimmten Jobs geschult werden müssen.
Die Alternative: sich so intensiv einzulesen, um die Technologie gut nutzen zu können. In der näheren Zukunft wird es also vor allem darauf ankommen, mit der Technologie und den gängigen Systemen umgehen zu können. Künstliche Intelligenz wird in der Arbeitswelt also erstmal wie ein:e Kolleg:in, die man entsprechend einschulen darf.
Bei der Wissensvermittlung sollte schon in der Schule angesetzt werden. Kompetenzerwerb von klein auf wäre hier ein erster wichtiger Schritt. Der Informatik-Unterricht in der Schule sollte nicht nur aus Word, Zehn-Finger-System und dem Erstellen aussagekräftiger Powerpoints bestehen. Vielmehr muss auf aktuelle Entwicklungen und Neuerungen eingegangen werden, die bei Schüler:innen spätestens in der Arbeitswelt eine Rolle spielen – tendenziell aber schon dann, wenn es um das Schreiben von Aufsätzen geht.
Der beste Tipp in vielen Lagen: Nichts geht über Wissen, das man sich selbst aneignet. Ausgestattet mit Wissen rund um die Technologie und einer guten Portion kritischer Auseinandersetzung sieht die Welt also schon wieder ganz anders aus. Da wird schnell klar: So schnell kann man den Mensch gar nicht ersetzen.
Was braucht es also in der Ausbildung von heute, um für die Arbeit von morgen gerüstet zu sein? Das haben wir in diesem Artikel kurz diskutiert.
Was bedeutet das für mich?
Und auch wir Student:innen sollten die Scheuklappen abnehmen und uns der Künstlichen Intelligenz mit Neugier nähern. Denn die Künstliche Intelligenz kommt, das ist sicher. Sie ist schon hier, um genauer zu sein. Unsicher ist aber, wie wir damit umgehen – das betrifft Einzelpersonen wie auch die Gesellschaft, den Arbeitsmarkt und die Politik.
Innerhalb der Europäischen Union wird deswegen aktuell der „AI Act“ verhandelt. Diese Verordnung soll die Nutzung von Künstlicher Intelligenz – oder Artificial Intelligence – regulieren. Neben den Risiken der Technologie wird auch der Nutzen in der Verordnung aufgezeigt. Der AI Act plant eine Einstufung in verschiedene Risikostufen, die mit unterschiedlicher Tiefe der Regulierung einhergehen. Gefordert wird im Allgemeinen aber mehr Transparenz und das Abbauen von Zugangsschranken. Der von der EU aufgesetzte AI Act wäre das weltweit erste Regelsystem, das KI-Nutzung auf länderübergreifender Ebene in einen gesetzlichen Rahmen steckt. Mehr dazu könnt ihr hier lesen.
So gerne wir Unterstützung annehmen, sollten wir uns eine Tatsache aber immer wieder vor Augen führen: Eine künstliche Intelligenz ist weder neutral, noch besitzt sie eine Moral oder ein ihr inhärentes Wertesystem. KI sammelt eine enorme Menge an Daten aus dem Internet. Sie spiegelt also Machtstrukturen und Meinungen wider, die nicht immer der Realität entsprechen. Falschmeldungen und Verzerrungen kommen häufig vor – und woher soll eine Maschine wissen, dass eben nicht immer alles, was im Internet steht, auch wirklich wahr ist?
Und die Zukunft?
Einen Ausblick zu geben, ist schwierig. Jedoch wollen wir euch die folgenden Dinge mit auf den Weg geben: So schlau die von einer Künstlichen Intelligenz generierten Antworten auch klingen mögen: bleibt skeptisch! Die „Check, Re-Check, und Double-Check“-Methode aus dem Journalismus kann euch die Schwächen der Technologie aufzeigen. Zeit sparen und den Text dann doch von einer Maschine schreiben lassen? Bevor du die Quellen und Aussagen auf Richtigkeit prüfst, kannst du dich auch gleich selbst an den Schreibtisch setzen.
Denn: Die KI ist noch lange nicht so ausgefeilt, dass man ihr blind vertrauen kann. Bildet euch weiter, hört euch Vorträge von führenden Forschenden in diesem Gebiet an oder lauscht spannenden Podcasts. Ein paar Tipps haben wir beispielsweise in diesem Artikel für dich zusammengefasst.
Ganz schön viel Eindrücke, die es hier zu fassen gibt. Fast täglich lesen wir in Tageszeitungen über neue Entwicklungen, immer mehr Weiterbildungen werden angeboten und in Sozialen Netzwerken wird Künstliche Intelligenz mal auf die Schaufel genommen, mal die eindrucksvolle Leistung präsentiert.
Was sich gerade so tut..
In einem Standard-Artikel vom November 2023 wird gezeigt, dass Künstliche Intelligenz vor allem in Großunternehmen – hier am Beispiel Deutschland – immer häufiger genutzt wird. Eine im September veröffentlichte Presseaussendung des EU Councils dokumentiert die aktuellen Verhandlungen rund um den geplanten AI Act – die erste längerübergreifende Abmachung zur Verwendung, ethischen Verankerung und Risikobewertung weltweit.
Interessieren dich weitere Artikel zu diesem Thema? Aus dem Arbeitsleben haben wir auch einen Artikel zu Möglichkeiten und Chancen durch ein Berufspraktikum. Oder nimmst du dir auch schon lange vor, eine Pause von Social Media zu machen? Unsere Erfahrungen haben wir hier für dich zusammengefasst. Wenn du im Lernstress bist, können dir diese Getränke vielleicht ein bisschen Energie spenden. Apropos lernen: Welcher Lerntyp du bist, kannst du in diesem Artikel herausfinden. Und zum Abschluss: Ein Hoch auf dich, wenn du dich gerade durch Prüfungen, Praktikum und Uni-Projekte schlägst. Ein paar interessante Fakten zum Thema Weinbau findest du hier.